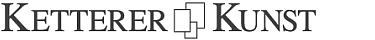Kein Wunder also, dass der mit enormem Sprachwitz begabte Künstler seine Passstücke als sichtbar gemachte Neurosen und Prothesen bezeichnete. Mit Medien und Materialien wie Gips, Papiermaché und Polyester verfertigt er diese Gebilde, hybride Objekte im Grenzbereich zwischen Skulptur und Aktion. Man sollte sie in die Hand nehmen, mit ihnen spielen, wie Prothesen sollten sie an den Körper gelegt werden. Erst mit der physischen Erfahrung, der weit über das Visuelle hinausgehenden Wahrnehmung der Nutzer, war seine Arbeit abgeschlossen. Später wird er sein Programm mit den kuriosen Möbeln und den Außenskulpturen erweitern – amorphe Formen, verkleidete Drahtgerüste, unakademisch und reichlich wurstig zusammengeschweißte Sitzgelegenheiten aus monochrom farbig oder weiß lackiertem Aluminium (Perfektionismus war nie angestrebt, im Gegenteil). Sie bewegen sich scheinbar durch den Raum, passen sich an, verweigern sich störrisch. Gleichen liegenden Exkrementen, sind phallische Metaphern. Sie sehen alle ein bisschen lustig aus, die Wuste, Qulze, Qwertze oder Patzen, wie er sie nennt. Beim zweiten Blick irritiert dann schon ihre hintergründige Ironie, durchwirkt von einer feinen, fast kränkelnden Melancholie. Fantasie ist gefordert, mehr noch rasch entflammte Empathie. Und eine gute Portion Sympathie für den speziell wienerischen Nihilismus.
Franz Wests künstlerische Eigenständigkeit, seine lebenslang behandelte Frage nach den Grenzen zwischen Kunst und Gebrauchsgegenstand hatte größten Einfluss. Irgendwelchen Strömungen ließ er sich zu keiner Zeit zuordnen. Mit seiner interaktiven Strategie galt er gleichwohl als radikaler Erneuerer der zeitgenössischen Kunst. Seine revolutionäre Haltung bezog sich grundsätzlich auf das unspektakuläre, dabei wirkmächtige Bestreben, sein Publikum zu ermuntern, die statische Haltung des Betrachters zu verlassen, um mit eigenem, mal mehr mal weniger ausgeprägtem Körpereinsatz selbst Bestandteil des Kunstwerks zu werden und es dabei in alle Richtungen assoziativ zu erkunden. Er wird als angenehmer, unaufgeregter Mensch beschrieben, dabei eigenwillig und ein Verächter pathetischer Bekundungen. Auf Konventionen pfiff er sowieso. Cool, sehr cool war er. Er kaufte sich zum Beispiel einen Maserati, hatte aber überhaupt keinen Führerschein. Er musste sich also dauernd kutschieren lassen. Dieses Symbol des Aufstiegs, ein selbstbezügliches Passstück sozusagen, hat er dann irgendwann kübelweise mit Farbe übergossen, hat die Neurose ruiniert. Oder ist das jetzt triviale Küchenpsychologie?
Unsere 300 mal 165 mal 160 Zentimeter messende Sitzskulptur von 2007 hat Franz West für den Vorplatz einer deutschen Firmensammlung mit zwei weiteren aus früheren Jahren zu einem Ensemble („Generally“) zusammengefügt. Das knallrot lackierte West-Geschöpf aus verschweißten Aluminiumteilen hat keinen Titel, sieht aus wie ein überdimensionaler zufällig zu Boden gefallener Tropfen. Oder wie ein Blütenblatt. Oder wie... Franz West wollte nie die Natur nachahmen, dazu war sie seiner Meinung nach viel zu perfekt, ihn reizte vielmehr der Kontrast, ihn interessierten die vielfältigen Interaktionen seiner Außenskulpturen in ihrem natürlichen Umfeld.
+ weitere Informationen
+ weitere Informationen