359
Otto Dix
Hamburger Kneipe, 1922.
Aquarell
Schätzung:
€ 60.000 Ergebnis:
€ 80.520 (inkl. Käuferaufgeld)
Hamburger Kneipe. 1922.
Aquarell, Ölkreide, Blei- und Farbstift.
Pfäffle A 1922/107. Rechts unten signiert, datiert und bezeichnet "171". Verso handschriftlich betitelt. Auf Zeichenpapier, Kanten jeweils mit Perforierung. 48,9 x 36,8 cm (19,2 x 14,4 in), blattgroß. [KP/JS].
Die sozialkritischen Arbeiten der 1920er Jahre gehören zu den gefragtesten Werken des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
Wir danken Herrn Rainer Pfefferkorn, Otto Dix Archiv, für die freundliche Beratung.
PROVENIENZ: Ehemals Sammlung Dr. Heinrich Stinnes.
Galerie Wolfgang Ketterer, 12. Auktion, München 1974, Lot 424, mit Abb. S. 68.
Galerie Achim Moeller, London 1986.
Privatsammlung Baden-Württemberg.
Privatsammlung Norddeutschland.
Der am 2. Dezember 1891 geborene Otto Dix wächst mit drei jüngeren Geschwistern in einer sozialdemokratisch gesinnten Familie am Rande der Residenzstadt Gera auf. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler und dem anschließenden Besuch der Kunstgewerbeschule in Dresden wird Dix' Ausbildung durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Vier Jahre lang ist Dix als Soldat in Frankreich, Flandern und Russland. Nach Kriegsende beginnt er ein Studium an der Dresdner Kunstakademie und wird zum Mitbegründer und Mittelpunkt der "Dresdner Sezession - Gruppe 1919". Im Herbst 1922 siedelt Otto Dix nach Düsseldorf über und wird an der Kunstakademie Meisterschüler von Heinrich Nauen und Wilhem Herberholz. Die Kriegserlebnisse werden für Dix Auslöser für seine beißend-kritischen Bilder wie u.a. "Der Schützengraben"(1923), welches neben zwei weiteren Gemälden einen Kunstskandal auslöst und den frühen Radier-Zyklus "Der Krieg".
Neben den Schrecken des Krieges, den Themen von Kampf, Tod, Verwundung und Vergänglichkeit, setzt sich Dix in der Nachkriegszeit - wie auch in der vorliegenden Arbeit - in seinem ganz eigenen, veristisch überzeichnenden Realismus auch verstärkt mit den Abgründen der menschlichen Sexualität und Triebhaftigkeit auseinander. Er wird zu einem kritischen Chronisten einer durch den Ersten Weltkrieg aus den Fugen geratenen Gesellschaft und erklärt fortan die moralisch beängstigenden Seiten des menschlichen Daseins sowie die allseits präsente finanzielle Not und Perspektivlosigkeit zu würdigen Bildthemen. Gänzlich ohne belehrenden Unterton hat Dix auf diese Weise nicht nur beeindruckende visuelle Zeitdokumente, sondern darüber hinaus in sicherem Strich und mit einem unverstellten künstlerischen Blick auf die Wirklichkeit Werke von besonderem kunsthistorischen Wert geschaffen.
Nach expressionistischen und dadaistischen Anfängen wendet sich Dix der Neuen Sachlichkeit zu, er siedelt im November 1925 nach Berlin über und avanciert zum profiliertesten Porträtmaler der Berliner Bohème und der intellektuellen Gesellschaft der Weimarer Republik. 1927 erhält er eine Professur an der Dresdner Akademie, aus der er 1933 entlassen wird und als "unerwünschter Künstler" schließlich Ausstellungsverbot erhält. Dix siedelt daraufhin nach Randegg bei Singen, drei Jahre später nach Hemmenhofen am Bodensee um. 1945 wird der Künstler zum "Volkssturm" eingezogen und gerät in Colmar in französische Gefangenschaft. Dix' Reisen nach Südfrankreich, Italien und Griechenland werden 1962 um einen Studienaufenthalt an der Villa Massimo in Rom und zwei Jahre später um die Ehrenmitgliedschaft an der Florentiner Accademia degli Arti del Disegno bereichert. Ab 1950 kommt es innerhalb seines Spätwerkes zu einer thematisch-stilistischen Wende, die von der urbanen Kultur zum Bukolischen, vom Polemisch-Realistischen ins Heiter-Expressive führt. Dix' Interesse gilt weiterhin dem Porträt, daneben spielen religöse Themen und die Landschaftsmalerei eine dominierende Rolle. Otto Dix gehört zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Sein Werk spiegelt in seiner Wandlungsfähigkeit die Zäsuren des Jahrhunderts wider, allerdings ohne je die Abstraktion mitzumachen, die Otto Dix bis ins hohe Alter abgelehnt hat.
Aquarell, Ölkreide, Blei- und Farbstift.
Pfäffle A 1922/107. Rechts unten signiert, datiert und bezeichnet "171". Verso handschriftlich betitelt. Auf Zeichenpapier, Kanten jeweils mit Perforierung. 48,9 x 36,8 cm (19,2 x 14,4 in), blattgroß. [KP/JS].
Die sozialkritischen Arbeiten der 1920er Jahre gehören zu den gefragtesten Werken des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
Wir danken Herrn Rainer Pfefferkorn, Otto Dix Archiv, für die freundliche Beratung.
PROVENIENZ: Ehemals Sammlung Dr. Heinrich Stinnes.
Galerie Wolfgang Ketterer, 12. Auktion, München 1974, Lot 424, mit Abb. S. 68.
Galerie Achim Moeller, London 1986.
Privatsammlung Baden-Württemberg.
Privatsammlung Norddeutschland.
Der am 2. Dezember 1891 geborene Otto Dix wächst mit drei jüngeren Geschwistern in einer sozialdemokratisch gesinnten Familie am Rande der Residenzstadt Gera auf. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler und dem anschließenden Besuch der Kunstgewerbeschule in Dresden wird Dix' Ausbildung durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Vier Jahre lang ist Dix als Soldat in Frankreich, Flandern und Russland. Nach Kriegsende beginnt er ein Studium an der Dresdner Kunstakademie und wird zum Mitbegründer und Mittelpunkt der "Dresdner Sezession - Gruppe 1919". Im Herbst 1922 siedelt Otto Dix nach Düsseldorf über und wird an der Kunstakademie Meisterschüler von Heinrich Nauen und Wilhem Herberholz. Die Kriegserlebnisse werden für Dix Auslöser für seine beißend-kritischen Bilder wie u.a. "Der Schützengraben"(1923), welches neben zwei weiteren Gemälden einen Kunstskandal auslöst und den frühen Radier-Zyklus "Der Krieg".
Neben den Schrecken des Krieges, den Themen von Kampf, Tod, Verwundung und Vergänglichkeit, setzt sich Dix in der Nachkriegszeit - wie auch in der vorliegenden Arbeit - in seinem ganz eigenen, veristisch überzeichnenden Realismus auch verstärkt mit den Abgründen der menschlichen Sexualität und Triebhaftigkeit auseinander. Er wird zu einem kritischen Chronisten einer durch den Ersten Weltkrieg aus den Fugen geratenen Gesellschaft und erklärt fortan die moralisch beängstigenden Seiten des menschlichen Daseins sowie die allseits präsente finanzielle Not und Perspektivlosigkeit zu würdigen Bildthemen. Gänzlich ohne belehrenden Unterton hat Dix auf diese Weise nicht nur beeindruckende visuelle Zeitdokumente, sondern darüber hinaus in sicherem Strich und mit einem unverstellten künstlerischen Blick auf die Wirklichkeit Werke von besonderem kunsthistorischen Wert geschaffen.
Nach expressionistischen und dadaistischen Anfängen wendet sich Dix der Neuen Sachlichkeit zu, er siedelt im November 1925 nach Berlin über und avanciert zum profiliertesten Porträtmaler der Berliner Bohème und der intellektuellen Gesellschaft der Weimarer Republik. 1927 erhält er eine Professur an der Dresdner Akademie, aus der er 1933 entlassen wird und als "unerwünschter Künstler" schließlich Ausstellungsverbot erhält. Dix siedelt daraufhin nach Randegg bei Singen, drei Jahre später nach Hemmenhofen am Bodensee um. 1945 wird der Künstler zum "Volkssturm" eingezogen und gerät in Colmar in französische Gefangenschaft. Dix' Reisen nach Südfrankreich, Italien und Griechenland werden 1962 um einen Studienaufenthalt an der Villa Massimo in Rom und zwei Jahre später um die Ehrenmitgliedschaft an der Florentiner Accademia degli Arti del Disegno bereichert. Ab 1950 kommt es innerhalb seines Spätwerkes zu einer thematisch-stilistischen Wende, die von der urbanen Kultur zum Bukolischen, vom Polemisch-Realistischen ins Heiter-Expressive führt. Dix' Interesse gilt weiterhin dem Porträt, daneben spielen religöse Themen und die Landschaftsmalerei eine dominierende Rolle. Otto Dix gehört zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Sein Werk spiegelt in seiner Wandlungsfähigkeit die Zäsuren des Jahrhunderts wider, allerdings ohne je die Abstraktion mitzumachen, die Otto Dix bis ins hohe Alter abgelehnt hat.
359
Otto Dix
Hamburger Kneipe, 1922.
Aquarell
Schätzung:
€ 60.000 Ergebnis:
€ 80.520 (inkl. Käuferaufgeld)
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.
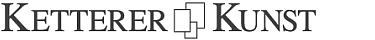



 Lot 359
Lot 359 

