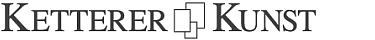Auktion: 590 / Evening Sale am 06.06.2025 in München  Lot 125000217
Lot 125000217
 Lot 125000217
Lot 125000217
125000217
Max Liebermann
Die Birkenallee im Wannseegarten, 1919.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 400.000 - 600.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Die Birkenallee im Wannseegarten. 1919.
Öl auf Leinwand.
Links unten signiert und datiert. 70,5 x 90,5 cm (27,7 x 35,6 in).
• Vollendetes Spiel von Licht und Schatten mit Blick in Richtung des durch die Birken glitzernden Wannsees.
• Nach dem Kriegsausbruch 1914 wird Liebermanns Villa am Wannsee zu seinem künstlerischen und privaten Rückzugsort.
• In den hier entstandenen Gemälden erreicht Liebermann eine neue Befreiung von Form und Farbe.
• Die berühmten Gartenbilder gehören zu seinen gesuchtesten Arbeiten auf dem internationalen Kunstmarkt.
• Liebermanns Darstellungen der Birkenallee befinden sich u. a. in den Sammlungen des Niedersächsischen Landesmuseums, Hannover, der Hamburger Kunsthalle und der Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin.
PROVENIENZ: Galerie Grosshennig, Düsseldorf.
Kunsthaus Bühler, Stuttgart (wohl 1963 vom Vorgenannten erworben, auf d. Keilrahmen m. d. Galerieetikett).
Sammlung Gabriele Zimmermann (geb. Bühler), Stuttgart (1974 durch Erbschaft vom Vorgenannten).
Privatsammlung Berlin (1998 von der Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Im Garten von Max Liebermann, Hamburger Kunsthalle, 11.6.-26.9.2004; Alte Nationalgalerie, Berlin, 12.10.2004-9.1.2005, S. 197, Kat.-Nr. 24 (m. Abb., S. 137).
Max Liebermann. Der Birkenweg - Ein Motiv zwischen Impressionismus und Jugendstil, Liebermann-Villa am Wannsee, Berlin, 27.4.-27.7.2008, S. 73 (m. Abb., S. 21).
LITERATUR: Matthias Eberle, Max Liebermann (1847-1935). Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien, Bd. II: 1900-1935, München 1996, S. 989, WVZ-Nr. 1919/23 (m. d. Titel "Die Birkenallee im Wannseegarten, Blick auf das Kohlfeld", m. Abb., S. 991).
- -
Martin Faass, Die Idee vom Haus im Grünen. Max Liebermann am Wannsee, Berlin 2010, S. 148 (m. ganzs. Abb.).
"Was in den Wannseebildern wirkt, ist die Stärke ihrer malerischen Übersetzung."
Erich Hancke, Max Liebermanns Kunst seit 1914, in: Kunst und Künstler, Jg. 20, 1922, S. 345.
Öl auf Leinwand.
Links unten signiert und datiert. 70,5 x 90,5 cm (27,7 x 35,6 in).
• Vollendetes Spiel von Licht und Schatten mit Blick in Richtung des durch die Birken glitzernden Wannsees.
• Nach dem Kriegsausbruch 1914 wird Liebermanns Villa am Wannsee zu seinem künstlerischen und privaten Rückzugsort.
• In den hier entstandenen Gemälden erreicht Liebermann eine neue Befreiung von Form und Farbe.
• Die berühmten Gartenbilder gehören zu seinen gesuchtesten Arbeiten auf dem internationalen Kunstmarkt.
• Liebermanns Darstellungen der Birkenallee befinden sich u. a. in den Sammlungen des Niedersächsischen Landesmuseums, Hannover, der Hamburger Kunsthalle und der Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin.
PROVENIENZ: Galerie Grosshennig, Düsseldorf.
Kunsthaus Bühler, Stuttgart (wohl 1963 vom Vorgenannten erworben, auf d. Keilrahmen m. d. Galerieetikett).
Sammlung Gabriele Zimmermann (geb. Bühler), Stuttgart (1974 durch Erbschaft vom Vorgenannten).
Privatsammlung Berlin (1998 von der Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Im Garten von Max Liebermann, Hamburger Kunsthalle, 11.6.-26.9.2004; Alte Nationalgalerie, Berlin, 12.10.2004-9.1.2005, S. 197, Kat.-Nr. 24 (m. Abb., S. 137).
Max Liebermann. Der Birkenweg - Ein Motiv zwischen Impressionismus und Jugendstil, Liebermann-Villa am Wannsee, Berlin, 27.4.-27.7.2008, S. 73 (m. Abb., S. 21).
LITERATUR: Matthias Eberle, Max Liebermann (1847-1935). Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien, Bd. II: 1900-1935, München 1996, S. 989, WVZ-Nr. 1919/23 (m. d. Titel "Die Birkenallee im Wannseegarten, Blick auf das Kohlfeld", m. Abb., S. 991).
- -
Martin Faass, Die Idee vom Haus im Grünen. Max Liebermann am Wannsee, Berlin 2010, S. 148 (m. ganzs. Abb.).
"Was in den Wannseebildern wirkt, ist die Stärke ihrer malerischen Übersetzung."
Erich Hancke, Max Liebermanns Kunst seit 1914, in: Kunst und Künstler, Jg. 20, 1922, S. 345.
"Wohnraum im Freien". Max Liebermanns Gartenparadies am Wannsee
1909 erwirbt Max Liebermann ein großzügig geschnittenes Seegrundstück am Wannsee bei Berlin, das sich auf einer Fläche von 200 mal 40 Metern vom Ufer des Wannsees bis zur damaligen "Großen Seestraße" erstreckt. In den darauffolgenden Monaten lässt er hier nicht nur eine Sommer-Residenz, die heute bekannte Liebermann-Villa, errichten, sondern gestaltet in Zusammenarbeit mit Alfred Lichtwark (1852–1914), dem damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, auch ein beeindruckendes, vielschichtiges Gartenparadies. Mithilfe künstlerisch-architektonischer Prinzipien werden Nutzgarten, Blumenbeete, Hecken, Sträucher, Bäume und Rasenflächen mit der umliegenden Seenlandschaft und der Villa selbst zu einer harmonischen Einheit verschmolzen – ganz dem englischen Verständnis des Gartens als "Wohnraum im Freien" folgend und wie Liebermann es bereits seit den 1880er Jahren bei seinen Aufenthalten in Noordwijk kennen und schätzen gelernt hatte. Schon damals schlagen sich seine Eindrücke und seine Freude an den hübschen Gärten in einigen Gemälden wieder: In "Stevenstift in Leyden" (Eberle 1889/6 und 1890/2) ist im rechten Bildteil beispielsweise ein üppiger, prachtvoll blühender Rosengarten dargestellt und einige Jahre später, vermutlich während eines Aufenthalts in Zandvoort, entstehen einzelne bäuerliche Gartenansichten, u. a. "Garten mit blühenden Sonnenblumen" (Eberle 1895/14). Durch Alfred Lichtwark lernt Liebermann in den 1890er Jahren schließlich auch die Schönheit des norddeutschen Bauerngartens kennen. Eine Entdeckung, die ihn einige Jahre später womöglich zum Erwerb des Grundstücks am Großen Wannsee beflügelt.
Blumenterrasse, Obstwiese und Rosengarten
Ab 1910 verhilft Liebermann der große Wannseegarten zu einer erstaunlichen künstlerischen Kreativität und Schaffenskraft. In den darauffolgenden Jahren entsteht eine Vielzahl reizvoller Darstellungen der prächtigen Anlage, die dem Künstler als stetige, sich mit den Jahreszeiten wandelnde, nie versiegende Inspirationsquelle dient. In dem Richtung Nordwesten ausgerichteten Garten-Areal befinden sich der Staudengarten, der Gemüsegarten, die Sommerblumenrabatten, ein Gärtnerhaus, mehrere Buchen- und Lindenhecken, eine große Kastanie und eine lange Fliederhecke. Richtung Südosten erstreckt sich vor der Terrasse, auf der Liebermann gerne verweilt, die geometrisch angelegte Blumenterrasse, daneben der "Otterbrunnen" mit einer Bronze von August Gaul, drei quadratisch eingefasste Heckengärten, das Lindenkarree, der ovale Garten und der Rosengarten mit Sonnenuhr, dahinter die Obstwiese mit Trauerweiden und einem kleinen Teepavillon direkt an der Uferpromenade, an die sich natürlich ein Bootssteg anschließt. Das restliche Grundstück zwischen Wannsee und Villa füllt eine große Rasenfläche sowie ein an der Seeseite beginnender und am seitlichen Rand des Grundstücks zum Haus führender Weg, der Birkenhain.
"Ich liebe es, daß man sieht, wie ein Stamm aus dem Boden kommt. Seine Form erhält dadurch eine ganz andere Eindringlichkeit."
Max Liebermann an Gotthard Jedlicka, zit. nach: Gloria Köpnick u. Rainer Stamm (Hrsg.), Max Liebermanns Garten, Berlin 2021, S. 60.
Birkenhain und große Rasenfläche: Verbindung zwischen Haus und Wannsee-Ufer
Die beiden links und rechts von der Rasenfläche gerade zum See führenden Gänge gehören zu den Hauptgedanken Alfred Lichtwarks bei der Planung und Strukturierung des großen Gartengrundstücks. Die für diese Gegend typischen Bäume gehören damals zum ursprünglichen Bestand des Grundstücks. Nicht als Allee (wie der Titel suggeriert), sondern als unregelmäßig verteilte, natürlich gewachsene Baumgruppe führen sie am Ufer des Wannsees entlang und bilden auch am Rande der Rasenfläche ein kleines, Schatten spendendes Wäldchen. Der Fußweg verläuft gerade, jedoch direkt durch den Hain hindurch, sodass sich einige Birken nun mitten auf dem Pfad befinden. "Sie sehen, daß die geraden Wege ohne Rücksicht auf die Bäume gezogen sind. Ich habe es so gewollt. Man hat mich damals überall ausgelacht. Man hat mich sogar als verrückt angesehen. Jetzt lassen auch die andern so bauen und die Wege auf ähnliche Weise anlegen. Ich liebe es, daß man sieht, wie ein Stamm aus dem Boden kommt. Seine Form erhält dadurch eine ganz andere Eindringlichkeit." (Max Liebermann an Gotthard Jedlicka, zit. nach: Gloria Köpnick u. Rainer Stamm (Hrsg.), Max Liebermanns Garten, Berlin 2021, S. 60)
Dieser von Birken gesäumte schmale Weg, der auch auf der hier angebotenen Darstellung zu sehen ist, bietet Liebermann während und nach dem Ersten Weltkrieg und auch in den 1920er Jahren neben den zahlreichen Blumenbeeten und -rabatten ein besonders reizvolles Motiv für seine Gartenbilder.
Das Gemälde "Die Birkenallee im Wannseegarten", 1919
1917 erscheint die Birkenallee erstmals in einzelnen Gemälden des Künstlers. 1918 beschäftigt er sich dann mit dem imposanten Blick durch die Birken über die Rasenfläche auf das Haus. Es entsteht eine kleine Motivreihe mit jeweils leicht veränderter Perspektive. Im darauffolgenden Jahr liegt sein Fokus stattdessen auf dem umgekehrten Blick in Richtung Wannsee. Auch das hier angebotene Werk entsteht in diesem Jahr, wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Mit stimmungsvoller Tiefenwirkung zeigt es den Blick vom Birkenhain hin zum Wannsee, der hier zwischen den Birkenstämmen als feiner, hellblauer Streifen erkennbar wird, auf dem – mit kurzen Pinselstrichen und äußerst pastosem Farbauftrag in Szene gesetzt – kleine Ruder- oder Segelboote schaukeln. Im Hintergrund links sind die den Rosengarten einrahmenden Bäume und Buchenhecken und hinten mittig die Bepflanzungen der Obstwiese zu erkennen.
Getragen wird die Darstellung von den zahlreichen, ebenfalls pastos gearbeiteten, sommerlichen Lichtflecken, die sich durch die Baumkronen der Birken auf Rasenfläche und Weg verteilen und die gesamte Szenerie in eine außerordentlich atmosphärische sommerliche Stimmung versetzen. Der leichte Wind vom Wannsee, das Rauschen der Blätter, die flackernden Lichtreflexe, das leise Summen der Bienen scheint förmlich wahrnehmbar.
Die Vielzahl an satten, frischen, die Komposition dominierenden Grüntönen durchzieht Liebermann mit spannungsvollen Farbakzenten: Die Lichtflecke bestehen aus hellem Sonnengelb und warmem Orange, der Hintergrund zeigt das kühle Hellblau des Wannsees und des mit weißen Wolken gespickten, sommerlichen Himmels und im Zentrum der Darstellung findet sich ein tiefes, kräftiges Violett der als schmaler Streifen dargestellten, abstrahierten Kohlköpfe, die mit dem Wannsee an der Horizontlinie eine harmonische Waagerechte zu den senkrechten Birken und Linden im Hintergrund bilden.
Hier ist die große, einst zwischen Birkenallee und Heckengärten befindliche Rasenfläche einem Gemüsefeld gewichen, denn nach dem sogenannten Steckrübenwinter 1916/17 entschließt sich der Künstler, seinen Garten möglichst landwirtschaftlich zu nutzen und die große Rasenfläche am Wannsee-Ufer mit Gemüse zu bepflanzen.
So gelingt es ihm, der katastrophalen Versorgungslage in diesen von großen Einschränkungen und Lebensmittelknappheit geprägten Zeiten ein wenig entgegenzuwirken, denn die allgemeine soziale, kulturelle und insbesondere ökonomische Lage dieser Jahre ist herausfordernd. Im Mai 1917 schreibt Liebermann an den Kunstsammler Heinrich Kirchhoff: "Sonst habe ich statt Gravensteiner Äpfel – Erdäpfel d. h. Kartoffeln gebaut und dazu Gemüse, Kohl und sonstiges Eßbare, denn, wer weiß, wie lange der Krieg noch dauert. Allerdings glaubt Mancher, daß im Herbste Frieden werden wird, aber wer weiß, was dann kömmt. Jedenfalls sollte Jeder seinen Kohl pflanzen." (Zit. nach: Martin Faass (Hrsg.), Max Liebermann, Briefe, Bd. 6: 1916-1921, S. 106, Nr. 113)
Max Liebermanns Wannseegarten wird ab 1910 zu seinem bevorzugten Rückzugsort und inspiriert ihn zu besonders reizvollen Gartenansichten, die heute als einer der Höhepunkte seines Œuvres gelten und zu seinen gesuchtesten Arbeiten auf dem internationalen Kunstmarkt gehören.
"Die Birkenallee im Wannseegarten" mit ihrem hellen, stimmungsvollen Kolorit und pastosem Farbauftrag vereint auf sehr reizvolle Weise die wichtigsten Elemente der berühmten Gartenbilder: Gartenarchitektur und Wannsee, Figurenstaffage und atmosphärische Lichtstimmung, ausgeklügelte Komposition und freier Farbauftrag, Alltagsrealität der Nachkriegsjahre und Leichtigkeit von Liebermanns charakteristischer Freilichtmalerei. [CH]
1909 erwirbt Max Liebermann ein großzügig geschnittenes Seegrundstück am Wannsee bei Berlin, das sich auf einer Fläche von 200 mal 40 Metern vom Ufer des Wannsees bis zur damaligen "Großen Seestraße" erstreckt. In den darauffolgenden Monaten lässt er hier nicht nur eine Sommer-Residenz, die heute bekannte Liebermann-Villa, errichten, sondern gestaltet in Zusammenarbeit mit Alfred Lichtwark (1852–1914), dem damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, auch ein beeindruckendes, vielschichtiges Gartenparadies. Mithilfe künstlerisch-architektonischer Prinzipien werden Nutzgarten, Blumenbeete, Hecken, Sträucher, Bäume und Rasenflächen mit der umliegenden Seenlandschaft und der Villa selbst zu einer harmonischen Einheit verschmolzen – ganz dem englischen Verständnis des Gartens als "Wohnraum im Freien" folgend und wie Liebermann es bereits seit den 1880er Jahren bei seinen Aufenthalten in Noordwijk kennen und schätzen gelernt hatte. Schon damals schlagen sich seine Eindrücke und seine Freude an den hübschen Gärten in einigen Gemälden wieder: In "Stevenstift in Leyden" (Eberle 1889/6 und 1890/2) ist im rechten Bildteil beispielsweise ein üppiger, prachtvoll blühender Rosengarten dargestellt und einige Jahre später, vermutlich während eines Aufenthalts in Zandvoort, entstehen einzelne bäuerliche Gartenansichten, u. a. "Garten mit blühenden Sonnenblumen" (Eberle 1895/14). Durch Alfred Lichtwark lernt Liebermann in den 1890er Jahren schließlich auch die Schönheit des norddeutschen Bauerngartens kennen. Eine Entdeckung, die ihn einige Jahre später womöglich zum Erwerb des Grundstücks am Großen Wannsee beflügelt.
Blumenterrasse, Obstwiese und Rosengarten
Ab 1910 verhilft Liebermann der große Wannseegarten zu einer erstaunlichen künstlerischen Kreativität und Schaffenskraft. In den darauffolgenden Jahren entsteht eine Vielzahl reizvoller Darstellungen der prächtigen Anlage, die dem Künstler als stetige, sich mit den Jahreszeiten wandelnde, nie versiegende Inspirationsquelle dient. In dem Richtung Nordwesten ausgerichteten Garten-Areal befinden sich der Staudengarten, der Gemüsegarten, die Sommerblumenrabatten, ein Gärtnerhaus, mehrere Buchen- und Lindenhecken, eine große Kastanie und eine lange Fliederhecke. Richtung Südosten erstreckt sich vor der Terrasse, auf der Liebermann gerne verweilt, die geometrisch angelegte Blumenterrasse, daneben der "Otterbrunnen" mit einer Bronze von August Gaul, drei quadratisch eingefasste Heckengärten, das Lindenkarree, der ovale Garten und der Rosengarten mit Sonnenuhr, dahinter die Obstwiese mit Trauerweiden und einem kleinen Teepavillon direkt an der Uferpromenade, an die sich natürlich ein Bootssteg anschließt. Das restliche Grundstück zwischen Wannsee und Villa füllt eine große Rasenfläche sowie ein an der Seeseite beginnender und am seitlichen Rand des Grundstücks zum Haus führender Weg, der Birkenhain.
"Ich liebe es, daß man sieht, wie ein Stamm aus dem Boden kommt. Seine Form erhält dadurch eine ganz andere Eindringlichkeit."
Max Liebermann an Gotthard Jedlicka, zit. nach: Gloria Köpnick u. Rainer Stamm (Hrsg.), Max Liebermanns Garten, Berlin 2021, S. 60.
Birkenhain und große Rasenfläche: Verbindung zwischen Haus und Wannsee-Ufer
Die beiden links und rechts von der Rasenfläche gerade zum See führenden Gänge gehören zu den Hauptgedanken Alfred Lichtwarks bei der Planung und Strukturierung des großen Gartengrundstücks. Die für diese Gegend typischen Bäume gehören damals zum ursprünglichen Bestand des Grundstücks. Nicht als Allee (wie der Titel suggeriert), sondern als unregelmäßig verteilte, natürlich gewachsene Baumgruppe führen sie am Ufer des Wannsees entlang und bilden auch am Rande der Rasenfläche ein kleines, Schatten spendendes Wäldchen. Der Fußweg verläuft gerade, jedoch direkt durch den Hain hindurch, sodass sich einige Birken nun mitten auf dem Pfad befinden. "Sie sehen, daß die geraden Wege ohne Rücksicht auf die Bäume gezogen sind. Ich habe es so gewollt. Man hat mich damals überall ausgelacht. Man hat mich sogar als verrückt angesehen. Jetzt lassen auch die andern so bauen und die Wege auf ähnliche Weise anlegen. Ich liebe es, daß man sieht, wie ein Stamm aus dem Boden kommt. Seine Form erhält dadurch eine ganz andere Eindringlichkeit." (Max Liebermann an Gotthard Jedlicka, zit. nach: Gloria Köpnick u. Rainer Stamm (Hrsg.), Max Liebermanns Garten, Berlin 2021, S. 60)
Dieser von Birken gesäumte schmale Weg, der auch auf der hier angebotenen Darstellung zu sehen ist, bietet Liebermann während und nach dem Ersten Weltkrieg und auch in den 1920er Jahren neben den zahlreichen Blumenbeeten und -rabatten ein besonders reizvolles Motiv für seine Gartenbilder.
Das Gemälde "Die Birkenallee im Wannseegarten", 1919
1917 erscheint die Birkenallee erstmals in einzelnen Gemälden des Künstlers. 1918 beschäftigt er sich dann mit dem imposanten Blick durch die Birken über die Rasenfläche auf das Haus. Es entsteht eine kleine Motivreihe mit jeweils leicht veränderter Perspektive. Im darauffolgenden Jahr liegt sein Fokus stattdessen auf dem umgekehrten Blick in Richtung Wannsee. Auch das hier angebotene Werk entsteht in diesem Jahr, wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Mit stimmungsvoller Tiefenwirkung zeigt es den Blick vom Birkenhain hin zum Wannsee, der hier zwischen den Birkenstämmen als feiner, hellblauer Streifen erkennbar wird, auf dem – mit kurzen Pinselstrichen und äußerst pastosem Farbauftrag in Szene gesetzt – kleine Ruder- oder Segelboote schaukeln. Im Hintergrund links sind die den Rosengarten einrahmenden Bäume und Buchenhecken und hinten mittig die Bepflanzungen der Obstwiese zu erkennen.
Getragen wird die Darstellung von den zahlreichen, ebenfalls pastos gearbeiteten, sommerlichen Lichtflecken, die sich durch die Baumkronen der Birken auf Rasenfläche und Weg verteilen und die gesamte Szenerie in eine außerordentlich atmosphärische sommerliche Stimmung versetzen. Der leichte Wind vom Wannsee, das Rauschen der Blätter, die flackernden Lichtreflexe, das leise Summen der Bienen scheint förmlich wahrnehmbar.
Die Vielzahl an satten, frischen, die Komposition dominierenden Grüntönen durchzieht Liebermann mit spannungsvollen Farbakzenten: Die Lichtflecke bestehen aus hellem Sonnengelb und warmem Orange, der Hintergrund zeigt das kühle Hellblau des Wannsees und des mit weißen Wolken gespickten, sommerlichen Himmels und im Zentrum der Darstellung findet sich ein tiefes, kräftiges Violett der als schmaler Streifen dargestellten, abstrahierten Kohlköpfe, die mit dem Wannsee an der Horizontlinie eine harmonische Waagerechte zu den senkrechten Birken und Linden im Hintergrund bilden.
Hier ist die große, einst zwischen Birkenallee und Heckengärten befindliche Rasenfläche einem Gemüsefeld gewichen, denn nach dem sogenannten Steckrübenwinter 1916/17 entschließt sich der Künstler, seinen Garten möglichst landwirtschaftlich zu nutzen und die große Rasenfläche am Wannsee-Ufer mit Gemüse zu bepflanzen.
So gelingt es ihm, der katastrophalen Versorgungslage in diesen von großen Einschränkungen und Lebensmittelknappheit geprägten Zeiten ein wenig entgegenzuwirken, denn die allgemeine soziale, kulturelle und insbesondere ökonomische Lage dieser Jahre ist herausfordernd. Im Mai 1917 schreibt Liebermann an den Kunstsammler Heinrich Kirchhoff: "Sonst habe ich statt Gravensteiner Äpfel – Erdäpfel d. h. Kartoffeln gebaut und dazu Gemüse, Kohl und sonstiges Eßbare, denn, wer weiß, wie lange der Krieg noch dauert. Allerdings glaubt Mancher, daß im Herbste Frieden werden wird, aber wer weiß, was dann kömmt. Jedenfalls sollte Jeder seinen Kohl pflanzen." (Zit. nach: Martin Faass (Hrsg.), Max Liebermann, Briefe, Bd. 6: 1916-1921, S. 106, Nr. 113)
Max Liebermanns Wannseegarten wird ab 1910 zu seinem bevorzugten Rückzugsort und inspiriert ihn zu besonders reizvollen Gartenansichten, die heute als einer der Höhepunkte seines Œuvres gelten und zu seinen gesuchtesten Arbeiten auf dem internationalen Kunstmarkt gehören.
"Die Birkenallee im Wannseegarten" mit ihrem hellen, stimmungsvollen Kolorit und pastosem Farbauftrag vereint auf sehr reizvolle Weise die wichtigsten Elemente der berühmten Gartenbilder: Gartenarchitektur und Wannsee, Figurenstaffage und atmosphärische Lichtstimmung, ausgeklügelte Komposition und freier Farbauftrag, Alltagsrealität der Nachkriegsjahre und Leichtigkeit von Liebermanns charakteristischer Freilichtmalerei. [CH]
125000217
Max Liebermann
Die Birkenallee im Wannseegarten, 1919.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 400.000 - 600.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Christoph Calaminus
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.