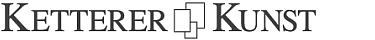Leider haben wir zu dieser Anfrage in Moment keine Treffer.
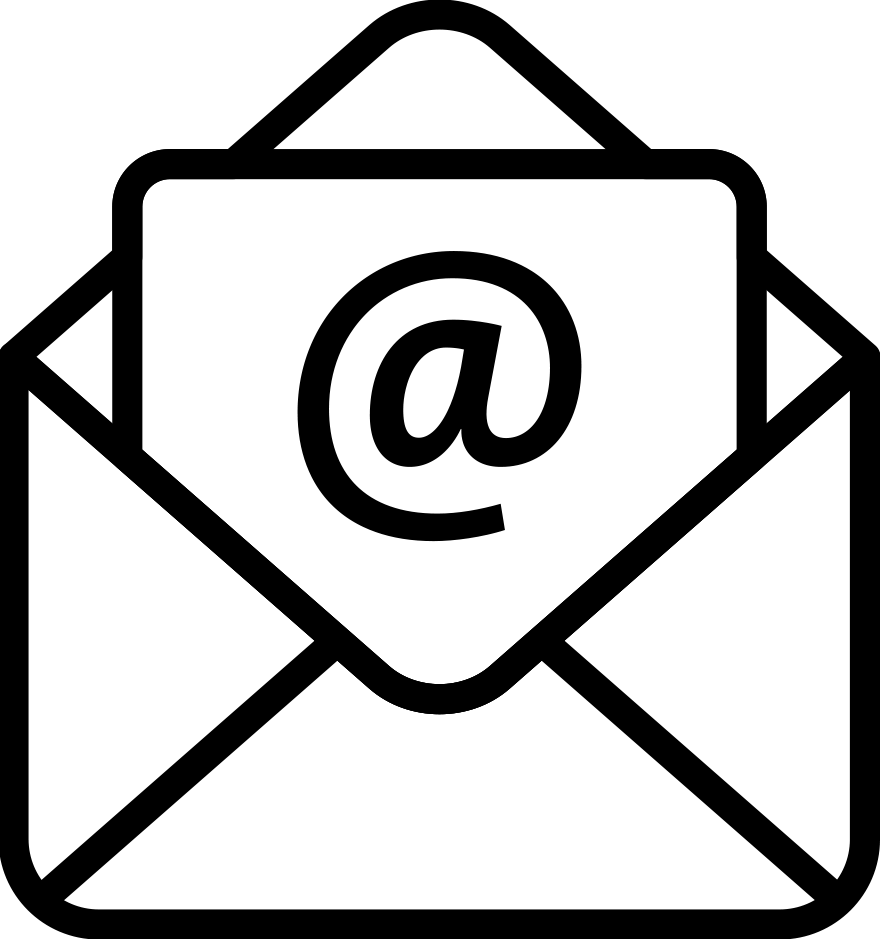
Ihre Lieblingskünstler im Blick!
- Neue Angebote sofort per E-Mail erhalten
- Exklusive Informationen zu kommenden Auktionen und Veranstaltungen
- Kostenlos und unverbindlich